Juli Zeh:
Corpus Delicti
Luchterhand München 2009 (btb 74066 412010) 348 S., 11,00 EUR
ISBN 978-3-442-74066-6
gelesen Januar 2025
Schlimmer geht immer!
Einmal mehr verägert uns die völlig überschätzte Autorin.
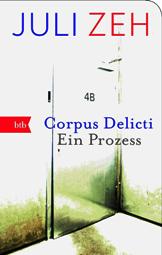
| Michael Seeger | Rezensionen | Forum |
|
|
Juli Zeh:Corpus DelictiLuchterhand München 2009 (btb 74066 412010) 348 S., 11,00 EUR ISBN 978-3-442-74066-6 gelesen Januar 2025 Schlimmer geht immer!Einmal mehr verägert uns die völlig überschätzte Autorin.
|
|
Bei meinem letzten Zeh-Verriss hatte ich postuliert, demnächst keinen Zeh-Roman mehr zu brauchen. Mehrere Bundesländer haben aber CORPUS DELICTI zur Abiturpflichtlektüre erhoben. Da dies auch für die deutschen Auslandsschulen gilt, wo ich demnächst bei einer Fortbildung als Referent tätig sein werde, bin ich quasi "dienstlich gezwungen", mich mit dem allseits mal wieder hoch gelobten Roman auseinanderzusetzen. Auf freiwilliger Basis hätte ich das Buch nach wenigen Seiten weggelegt.
Dystopie scheint Zehs schriftstellerische Domäne zu sein. Die "Handlung" spielt in der Mitte des 21. Jahrhundert. Vielleicht greift Zeh deshalb mal wieder zum mir verhassten Präsens als Erzählzeit; oder auch, damit sie sich super-auktorial einschalten und dem Leser den Wechsel ins Präteritum erklären kann, wenn es um den Tod von Moritz geht. Moritz ist der im Suizid verstorbene geliebte Bruder der Protagonistin Mia, welche schon im Prolog "zum Einfrieren auf unbestimmte Zeit verurteilt" (S. 10) ist. Es herrscht eine Gesundheitsdiktatur im - gesichtslosen - Staat. METHODE wird das System und die dahinter steckende Ideologie genannt. Der Überwachungsstaat - mit sichtlichen Anklängen an Huxleys "Schöne neue Welt" - verpflichtet seine Bewohner zu aseptischen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften. Die Menschen tragen einen Chip im Oberarm, der jederzeit ausgelesen werden kann, um zu kontrollieren, ob die Menschen ihre Fitness-Auflagen erfüllt haben. Gegrüßt wird mit "Santé", getrunken wird heißes Wasser, die Kalorienzufuhr erfolgt aus "Nahrungsmitteltuben" (S. 211). Im Gefämgnis trägt Mia einen Papieranzug. Ein allmächtiger "Methodenschutz" wacht über die Einhaltung der gebotenen Maßnahmen. Moritz, die einzige Figur, von der im Präteritum erzählt wird, versteht sich als selbständiges Individuum, studiert Philosophie und hat von ihr die Motivation zum Widerstand. Der äußert sich in einer Hingabe an die Natur (Angeln). Er wird fälschlicher Weise der Vergewaltigung, des Mordes und des Terrorismus verdächtigt und verfolgt. Nach seinem Freitod tritt die Naturwissenschaftlerin Mia sein geistiges Erbe an. Dabei ist sie stets im Dialog mit einer "idealen Geliebten", einer rätselhafte Figur, die sich dem Leser nie erschließt. Der Widerpart zur mehr und mehr aufklärisch-rebellischen Mia ist ein System-Journalist names Heinrich Kramer, der im Leben Mias und vor Gericht wie ein allmächtiger Mephisto agiert. Er hat wie selbstverständlich Zugang zum Gericht, Gefängnis, Mias Wohnung.
Auf der Ideenebene handelt der Roman vom Kampf des Individuums gegen den Totalitarismus, von Freiheit versus Kontrolle, von Menschenwürde versus Konformität. Alles Konflikte, welche man aus den bekannte Dystopien kennt. Um den (Mehr)Wert des Romans gegenüber seinen zahlreichen Vorgängern zu manifestieren, müsste also seine Konstruktion, die Erzähltechnik, die Figurenzeichnung, die Sprache überzeugen. All dies kann Julie Zeh nicht. 1
Im Gegenteil: Eine Handlung gibt es eigentlich nicht. Die Figuren sind Ideenträger, fleischlose Plastikmenschen. Ein Plot wird nicht erzählt; das "Geschehen" entwickelt sich fast ausschließlich in völlig abstrusen, aufgesetzten, der Situation unangemessenen Dialogen, ohne dass man das Attribut "szenisches Erzählen" vergeben könnte. Die Richterin, welche mit ihrem Vornamen "Sophia" eingeführt wird, redet ebenso ordinär wie ihr vorsitzender Kollege Hutschneider:
"Wollen Sie mich eigentlich verarschen?" (S. 66) oder "Verdammt noch mal .... Ich will, dass die Ruhestörer kaltgestellt werden." (S. 256)
Die das Buch beherrschenden Dialoge sind allesamt unauthentisch, etwa wenn sich Mia - von brutaler Folter gekennzeichnet und mit einer dünnen Nadel blutreich den Chip aus dem Arm bohrend - mit dem gnadenlosen Ideologen Kramer in aller Konzentriertheit pseudoexistenzialistisch über den Sinn des Lebens und die Dichotomie Freiheit vs. Sicherheit unterhält, als säße sie in einem Literatursalon des 18. Jahrhunderts. Und das geht über mehrere Seiten so.
An den wenigen Stellen, an denen die Autorin mal auktorial so etwas wie einen Erzählbericht liefert, sind Sprache und Aussage - auf trivialliterarische Weise - philosophisch und lyrisch bemüht und nahe am Kitsch:
"Draußen verwässert erstes Morgenlicht das satte Nachtschwarz des Himmels. Es ist der Moment, in dem Gestern zu Morgen wird und es für eine kurze Zeit kein Heute gibt." (S. 55)
Gute Literatur entfesselt ja u.a. durch Leerstellen die Phantasie des Lesers. Dass sich Mia aber zum Peiniger Kramer auch ein wenig erotisch hingezogen fühlt, entwickelt sich nicht im Ungesagten, sondern quasi instruktiv durch Zehs Erklärung: "Mias Verhältnis zu Kramer ist ambivalent." (S. 126)
Zeh versucht, eine aseptische, technologisch futuristische Apparatenwelt zu imaginieren. Da wird ständig gescannt, ausgelesen, durchleuchtet, projiziert ... und dann bringt Kramer zum Besuch in der Zelle ganz anachronistisch einen Stapel Tageszeitungen mit. Und die Hausgenossinnen in Mias "Wächterhaus" schauen Nachrichten im altmodischen Fernsehen!
Isoliert gibt es durchaus ein paar schöne Sentenzen, die aber nie in einem sprachlich überzeugenden Konzept platziert sind. Mia kann "mit dem Herzen denken" (S. 183), unsere "kalten Herzen" (Titel eines anderen Zeh-Romans!), aber nicht erwärmen, weil die Geschichte nie berührt.
Wie schon erwähnt, plaudert Mia mit Kramer - nackt und gequält nach entsetzlicher Folter - im Talkshow-Stil, wo durchaus gute Formulierungen fallen, wenn auch moralisch überdehnt:
"Was ist, angesichts Ihrer Würde, der Mensch?"
"Das weiß ich nicht", sagt Mia trotzig.
"Dann denken Sie gefälligst darüber nach! Ich gebe Ihnen vierundzwanziig Stunden."(...) Mia: "Das Mittelalter ist keine Epoche. Mittelalter ist der Name der menschlichen Natur." (S. 234f)
Wie endet die Geschichte? Wir kennen aus der Dreigroschenoper den "Reitenden Boten", aus Faust I die "Stimme von oben" ("Gerettet!"). Das wird da jeweils angemessen ironisiert. Zeh aber lässt im Finale ohne jede ironische Distanz kurz vor dem Vollzug des Einfrierens Staatsanwalt Bell "buchstäblich in letzte Sekunde" (S. 262) die Begnadigung durch den Methodenrat verkünden. Weiterleben unter psychiatrischer Überwachung und Umerziehung bedeutet diese Gnade.
"Nein!" schreit Mia. (S. 264)
Mein "Nein" gilt diesem Buch.
Michael Seeger, 22. Januar 2025
© 2002-2025 Michael Seeger, Letzte Aktualisierung 22.01.2025